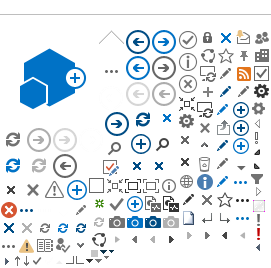Zurück zur Startseite des Programmbereichs
Zurück zur Startseite des Programmbereichs
Beitrag zur Forschung des ZALF
Der Programmbereich 1 „Landschaftsprozesse“ betreibt in sechs Arbeitsgruppen eine erkenntnisorientierte Forschung, welche die Aufklärung von Prozessen, Ursache-Wirkungszusammenhängen und Kausalketten sowie die Interaktionen innerhalb und zwischen verschiedenen Landschaftselementen wie z. B. Acker, Grünland, Gewässer und Wald umfasst. Dabei sind Gedächtniseffekte zu beachten, d.h. die mittel- und langfristigen Effekte früherer Maßnahmen bzw. Eingriffe in Agrarlandschaften. Die Forschungsarbeiten im Programmbereich schließen die Entdeckung und Analyse neuer Phänomene, eine kontinuierliche Methodenentwicklung sowie die Analyse von Prozessdynamiken mittels Kopplung von Daten mit Modellen ein.
Das Ziel unserer Forschung ist ein verbessertes Verständnis der biogeochemischen Kreisläufe (Kohlenstoff, Stickstoff, Silizium) und der sie treibenden Kräfte (Boden, Pflanzen, Mikroorganismen) in Agrarlandschaften. Hier werden die Forschungsarbeiten der einzelnen Arbeitsgruppen miteinander verknüpft. Die erzielten Erkenntnisse fließen in die Entwicklung nachhaltiger Landmanagementsysteme ein, wie sie in den Programmbereichen 2 und 3 entwickelt werden. Bei skalenübergreifenden Forschungsfragen arbeitet Programmbereich 1 eng mit der Forschungsplattform
„Datenanalyse und Simulation" sowie dem Programmbereich 3
„Agrarlandschaftssysteme“ zusammen. Zentrale Plattform für die Untersuchungen und Experimente auf der Feld- und Landschaftsskala stellt das AgroScapeLab Quillow innerhalb der Experimentellen Infrastrukturplattform dar.
Arbeitsgruppen
Landschaftspedologie
Die Arbeitsgruppe verfolgt das strategische Ziel, durch die skalenübergreifende Analyse der Kopplung von Bodenprozessen und Bodenfunktionen an raum-zeitlich veränderliche Strukturen ein verbessertes Verständnis der Entwicklung und Funktionalität von Bodenlandschaften zu entwickeln – von der Mikro- bis zur Landschaftsskala. Mittels Verknüpfung von experimentellen Ansätzen, Langzeitmessungen, Modellierung und einer kontinuierlichen Methodenentwicklung werden insbesondere landschaftsskalige C- und Nährstoffdynamiken, Rückkopplungsprozesse der Bodenerosion (v.a. Wind) und die langfristige Entwicklung von Bodenlandschaften und deren Folgewirkung auf die Bodenfruchtbarkeit erforscht.
Mehr ...
Kontakt:
Prof. Dr. Michael Sommer
Silizium-Biogeochemie
Die Arbeitsgruppe Silizium-Biogeochemie (SIB) verfolgt das Ziel, ein verbessertes Verständnis der Interaktionen zwischen verschiedenen Silizium-(Si)-Spezies, deren Verfügbarkeit, und der Nährstoff- und Wasserverfügbarkeit in agrarischen Systemen zu entwickeln. Unsere Forschungsfragen adressieren dabei vor allem die Si-Speziierung, deren Bindungsstärke, die zeitliche Si-Dynamik und die Steuergrößen des Si-Kreislaufes in agrarischen Systemen. Wir arbeiten von der Arktis bis zu den Tropen. Bodenchemie, die sich mit der Bindungskonkurrenz zwischen Nährstoffen und verschiedenen Si-Spezies um die Bindung an der Oberfläche von Bodenmineralen beschäftigt bis hin zu Prozessen auf dem Ökosystemlevel (Treibhausgasfreisetzung) gehören zu unserem Portfolio, genauso wie die Abmilderung von Trockenstress durch amorphes Si sowie die Analyse der Zusammenhänge zwischen Graslandbiodiversität und Si-Umsatz.
Mehr ...
Kontakt:
apl. Prof. Dr. Jörg Schaller
Isotopen-Biogeochemie & Gasflüsse
Zentrales Anliegen der Arbeitsgruppe ist die Untersuchung von Schlüsselprozessen, die den Stoff- und Wasserfluss innerhalb des Boden-Pflanze-Atmosphären-Kontinuums (SPAC) von Agrarlandschaften maßgeblich regulieren. Hierfür werden Isotopentechniken, Methoden zur Messung von Gasflüssen und pflanzenphysiologische Untersuchungen miteinander kombiniert. Die gezielte Verknüpfung dieser Ansätze und deren Weiterentwicklung in Rahmen interdisziplinärer sowie multiskaliger Vorhaben ermöglicht die integrative Analyse und Quantifizierung von Stoffflüssen entlang des SPAC sowie die Aufklärung von deren Regulation. Derzeitig werden in der Arbeitsgruppe Fragen zur Rolle der Erosion für die C- und N-Dynamik in Agrarlandschaften, zur Bedeutung von Rhizosphärenprozessen für die Rhizodeposition und Stoffaufnahme sowie zum Wasserhaushalt und zur Wassernutzungseffizienz von Ökosystemen untersucht.
Mehr ...
Kontakt:
PD Dr. Maren Dubbert
Mikrobielle Biogeochemie

Die terrestrische Mikrobiota in Aktion. Die Arbeitsgruppe erforscht die Bedeutung der Mikrobiota für (i) das Klima, (ii) den Kohlenstoffvorrat im Boden und (iii) die Resilienz von Pflanzen. Sie erforscht dafür die Mikrobiota in Landschaftselementen von Agrarlandschaften. Der Schwerpunkt der Forschung liegt dabei auf Acker- und Grünländern. Ausgewählte Getreide- und Baumarten dienen als Modellpflanzen. Die Gruppe nutzt Genmarker, Metagenomik, stabile Isotopenbeprobung und RNA-basierte Methoden einschließlich Bioinformatik, um Funktionen und Dynamik der Pflanzen- und Bodenmikrobiota zu bestimmen. Sie nutzt die Messungen von Bodenenzymen und Gasanalytik, um den mikrobiellen Stoffwechsel und die Emissionen von Treibhausgasen und VOCs zu charakterisieren. Experimentelle Untersuchungen werden sowohl auf der Skala der Einzelpflanze (Topfexperimente) als auch auf der Ebene von Ökosystemen (Feld- & Landschaft) durchgeführt. Darüber hinaus ist die Ökophysiologie von Methylotrophen und Nitratreduzierern (inkl. anaerober Kultivierung & Genomik) ein Untersuchungsgegenstand.
Mehr ...
Kontakt:
Prof. Dr. Steffen Kolb
Pilzliche Interaktionen
Die Arbeitsgruppe erforscht Interaktionen zwischen phytopathogenen Pilzen und Bakterien bzw. anderen Pilzen und deren Folgewirkungen auf die Biomasse-Bildung von Kulturpflanzen, insbesondere beim Weizen (Triticum L.). Langfristiges Ziel dabei ist, diese Interaktionen in kombinierten Labor-, Klimakammer-, Parzellen- und Feldversuchen aufzuklären und darauf Landschaftsexperimente aufzubauen und die Wirkmechanismen und Einflussfaktoren auf der Landschaftsskala zu verstehen. Die Arbeitsgruppe bedient sich dabei Methoden aus der Mykologie und der Phytotoxikologie und kombiniert mykologische und biochemische Methoden mit Mikrometereologie und Fernerkundung.
Mehr ...
Kontakt:
Dr. Marina Müller
Bodenerosion und Rückkopplungen
Die Arbeitsgruppe “Bodenerosion und Rückkopplungen (SEF)“ untersucht unterschiedliche Bodenerosionsprozesse die durch Wind-, Wasser- oder anthropogene Einwirkungen entstehen sowie deren Wechselwirkungen mit der Landschaft und ihren Funktionen. Hierfür nutzen wir eine transdisziplinäre Herangehensweise die quantitative und qualitative Ansätze nutzt, um Bodenerosionsprozesse zu erfassen, deren Dynamik abzuschätzen, sowie die verantwortlichen Treiberkräfte zu ermittelt. Ein Kernpunkt der Arbeitsgruppe ist die Integration von unterschiedlichen Erosionsprozessen auf Landschaftsebene.
Mehr ...
Kontakt: Dr. Michael Märker
 Zurück zur Startseite des Programmbereichs
Zurück zur Startseite des Programmbereichs