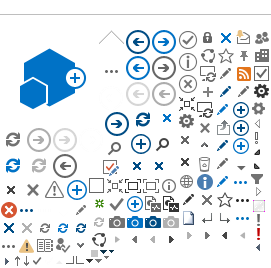15.10.2024

Soziale Lernprozesse können eine entscheidende Rolle in der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen spielen. Dies zeigt eine neue Studie, die im
Journal of Humanities and Social Sciences Communications veröffentlicht wurde. Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) hat die globale Analyse geleitet. Die Forschenden untersuchten 137 Fallstudien aus fünf Kontinenten, um die Muster und Mechanismen von sozialem Lernen in der Bewirtschaftung von Ressourcen zu identifizieren.
Soziales Lernen ist ein Prozess, bei dem Menschen in Gruppen oder Netzwerken Wissen austauschen und gemeinsam Lösungen für Probleme entwickeln. Besonders in der Bewirtschaftung von Ressourcen, wie Wasser oder Boden, sind diese Lernprozesse von großer Bedeutung, da sie helfen können, nachhaltigere Ansätze zu entwickeln.
Die Studie identifiziert zwei Haupttypen von sozialem Lernen: endogenes und exogenes Lernen. Beide Typen haben das Potenzial, die Nutzung von Ressourcen positiv zu beeinflussen, insbesondere in Regionen des globalen Südens, wo partizipative Ansätze eine größere Rolle spielen könnten.
Prof. Michelle Bonatti, Leiterin der Studie am ZALF erklärt: „Endogenes soziales Lernen, also Lernprozesse, die innerhalb einer Gemeinschaft entstehen, haben das Potenzial, langfristige und nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Besonders in Ländern des globalen Südens können diese Prozesse dazu beitragen, lokale Gemeinschaften zu stärken und die partizipative Entscheidungsfindung zu fördern.“
Soziales Lernen und Nachhaltigkeit – Eine globale Perspektive
Exogenes Lernen bringt wertvolles externes Wissen und Innovationen, die lokale Praktiken ergänzen können. Es kann jedoch auf Widerstand stoßen, wenn externe Lösungen nicht mit den lokalen Bedingungen übereinstimmen. Die Studie zeigt, dass exogenes Lernen in Regionen des Globalen Südens häufig durch Machtungleichgewichte behindert wird, da externe Akteure den sozialen und kulturellen Kontext der Gemeinschaft möglicherweise nicht vollständig verstehen oder respektieren.
„Exogenes Lernen bietet neue Perspektiven, kann aber problematisch sein, wenn lokale Gemeinschaften das Gefühl haben, dass ihre Erfahrungen ignoriert werden“, sagt Michelle Bonatti. „Eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren ist daher entscheidend, um Vertrauen aufzubauen und den Lernprozess zu verbessern.“
Die Studie unterstreicht, dass endogenes Lernen besonders in marginalisierten Gemeinschaften im globalen Süden von Vorteil ist, wo externe Akteure oft auf Skepsis stoßen. Endogenes Lernen stärkt gemeinschaftsbasierte Ansätze, die auf kollektivem Handeln und partizipativer Entscheidungsfindung basieren. Es wird zu einem Katalysator für soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung, indem es lokale Ressourcen und lokales Wissen nutzt, anstatt sie zu untergraben.
Zukunftsaussichten und Forschungsbedarf
Die Ergebnisse der Studie betonen die Notwendigkeit weiterer Forschungen zu sozialen Lernprozessen. Zukünftige Projekte sollten insbesondere darauf abzielen, die langfristigen Auswirkungen von endogenem Lernen auf die nachhaltige Ressourcennutzung zu analysieren und Methoden zu entwickeln, um solche Lernprozesse gezielt zu fördern.
„Die Studie zeigt deutlich, dass soziale Lernprozesse nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch das Vertrauen und die Zusammenarbeit in Gemeinschaften fördern können. Gerade in der nachhaltigen Bewirtschaftung von Ressourcen ist dies ein wichtiger Schritt, um langfristige Lösungen zu entwickeln“, betont Prof. Michelle Bonatti.
Projektpartner:
- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) (Germany)
- Ressourcenökonomie Gruppe, Humboldt-Universität zu Berlin (Germany)
- Crop Production Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden)
- Hasso-Plattner-Institut, Universität Potsdam (Germany)
- Abteilung für Gemeinschaftsenergie und Klimaanpassung, Technische Universität Berlin (Germany)
- Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) (Germany)
- WWF Mediterranean Marine Initiative (Italy)
- Vila Velha University (Brazil)
- Education Department, Florianópolis City Hall (Brazil)
- Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB) (Germany)
- Federal University of Santa Catarina (Brazil)
- Applied Systems Thinking in Practice Research Group, The Open University (UK)
- IRRI CGIAR International Rice Research Institute (Philippines)
- GGRIAR CGIAR Climate Security Office
- French National Research Institute for Sustainable Development (IRD), UMR DIADE, University of Montpellier (France)
- Centre for Regional Studies on Adaptation to Drought (CERAAS), Laboratoire Mixte International (Senegal)
- French National Research Institute for Sustainable Development (IRD), UMR Espace-Dev, University of Montpellier (France)
- AR4D Knowledge Sharing Consultant (UK)
Förderhinweis:
Open Access Finanzierung ermöglicht und organisiert durch das Projekt DEAL.
Weitere Informationen:
Hinweis zum Text:
Dies ist eine mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellte Zusammenfassung des Originaltextes: Bonatti, M., Lana, M., Medina, L. et al. (2024). Global analysis of social learning’s archetypes in natural resource management: understanding pathways of co-creation of knowledge. Humanities and Social Sciences Communications.
https://www.nature.com/articles/s41599-024-03590-5, veröffentlicht unter der Lizenz CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Der Text wurde unter den Gesichtspunkten der KI-Regelungen am ZALF sorgfältig überprüft und überarbeitet.