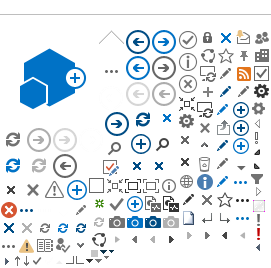17.10.2024

In einem Übersichtsartikel haben Forschende des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) untersucht, wie sich der Klimawandel weltweit auf die Ernten auswirkt. Dazu wurden experimentelle und modellbasierte Studien ausgewertet und der Einfluss von höheren Temperaturen, veränderter Wasserverfügbarkeit und erhöhtem CO2-Gehalt auf die Erträge der Kulturarten Weizen, Mais, Hirse und Reis untersucht. Es wird deutlich, dass sowohl die Einflüsse als auch die Auswirkungen stark von der Getreideart, der Region und der Anbaumethode abhängen. Der Artikel erschien im November 2023 in Nature Reviews Earth & Environment und gehört inzwischen zu den höchst zitierten Artikeln im Erscheinungszeitraum im Bereich der Geowissenschaften.
Der Klimawandel wird voraussichtlich in vielen Regionen zu Ertragseinbußen führen, da höhere Temperaturen den Trockenstress verstärken und das Risiko von Ernteausfällen erhöhen. Eine höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre und wärmere Temperaturen könnten hingegen in höheren Lagen sogar zu höheren Erträgen führen. Dies gilt beispielsweise für Weizen und Reis in Skandinavien. Dazu kommt, dass durch kürzere Winter in den gemäßigten Zonen die Vegetationsperioden länger werden und die Pflanzen mehr Zeit haben zu wachsen. Im Gegensatz werden die Erträge in den Tropen wegen zu hoher Temperaturen und Wassermangel sinken. Dies kann auch nicht vollständig dadurch kompensiert werden, dass die Landwirtschaft angepasst wird. Für alle Regionen der Welt gilt, dass extreme Wetterereignisse eine erhebliche Bedrohung für die zukünftige Ernährungssicherheit darstellen.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass es keine einfache und allgemeingültige Lösung gibt, um Erträge vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Regional angepasste Anpassungsstrategien sind der Schlüssel, um Ernteverluste zu minimieren", sagt
Dr. Ehsan Eyshi Rezaei, Erstautor des Artikels und Wissenschaftler am ZALF. „Bewässerung und Anpassungen im Nährstoffmanagement sind die vielversprechendsten Optionen. Sie erfordern aber oft hohe Investitionen seitens der Landwirtschaft. Zudem ist Bewässerung nicht in allen Regionen im erforderlichen Umfang möglich, da die Ressourcen begrenzt sind“, so Dr. Rezaei weiter.
Viele Faktoren wirken zusammen
Viele verschiedene Faktoren beeinflussen die Veränderungen der Ernteerträge: erhöhte CO2-Konzentrationen, steigende Temperaturen, Extremwetterereignisse, Hitze und eine veränderte Wasserverfügbarkeit. Je nach Region, Anbausystem und Nutzpflanze wirken sich diese Faktoren unterschiedlich stark aus. Dies haben die Forschenden in ihrem Review berücksichtigt und sind damit einen Schritt weiter gegangen als bisherige Studien, die diese Faktoren meist isoliert betrachtet haben. Sie haben experimentelle und modellbasierte Studien ausgewertet und liefern nun eine bessere Grundlage für die Entwicklung regional angepasster Strategien, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft besser abzufedern.
Der Artikel wurde im November 2023 in Nature Reviews Earth & Environment veröffentlicht und fand in der Fachwelt große Beachtung. Er wurde bereits im ersten Jahr nach Erscheinen sehr häufig zitiert und gehört zu den Top 1 Prozent im Bereich der Geowissenschaften.
Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass sich zukünftige Forschung auf die Durchführung von Multifaktor-Experimenten und die Entwicklung von Modellen konzentrieren sollte, die biotischen Stress ganzheitlich betrachten, um die Reaktionen von Nutzpflanzen auf den Klimawandel besser zu verstehen. Durch die Kombination von prozess- und datenbasierten Modellen können Ertragsvorhersagen verbessert werden, während hochauflösende Datenerhebungen die Genauigkeit von Klimafolgenabschätzungen erhöhen. Darüber hinaus werden fortschrittliche Anpassungsstrategien wie optimierte Bewässerung und Nährstoffmanagement von entscheidender Bedeutung sein, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Pflanzenproduktion zu mindern.
Projektpartner:
-
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Müncheberg, Deutschland.
-
Institut für Umweltwissenschaften und Umwelttechnik, Brandenburgische Technische Universität, Cottbus-Senftenberg, Deutschland.
-
Department of Life Science Engineering, Digital Agriculture, HEF World Agricultural Systems Center, Technische Universität München, Freising, Deutschland.
-
Agricultural and Biological Engineering, University of Florida, Gainesville, FL, USA.
-
Unité de Recherches Pluridisciplinaire Prairies et Plantes Fourragères (P3F), INRAE, Lusignan, Frankreich.
-
Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES), Universität Bonn, Bonn, Deutschland.
-
LEPSE, Université Montpellier, INRAE, Institut Agro Montpellier, Montpellier, France.
-
Soil and Irrigation Research Centre, College of Basic and Applied Sciences, University of Ghana, Kpong, Ghana.
Förderhinweis:
Diese Arbeit wurde unterstützt durch das Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project AgMIP, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Projekt-Nr. 520102751), die DFG im Rahmen der Exzellenzstrategie Strategie – EXC 2070–390732324, das EU-Projekt Horizon 2020 (Fördernummer 727247), das Meta-Programm „Land- und Forstwirtschaft im Klimawandel: Anpassung und Minderung“ (CLIMAE) und die Abteilung AgroEcoSystem des französischen Nationalen Forschungsinstituts für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt (INRAE).