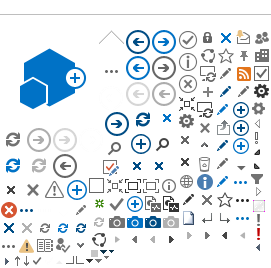Unsichtbar sitzen sie im Boden, an organischem Material, an Wurzeln und Pflanzenblättern. Millionen von Mikroorganismen bevölkern jeden Krümel Erde und jeden Quadratmillimeter pflanzlicher Oberfläche. Bakterien, Pilze und Hefen sind die wichtigsten Organismen dieses Mikrokosmos, der zunehmend in den Fokus der Forschung tritt. Denn die kleinsten Bewohner unseres Planeten haben ungeahnt großen Einfluss, zum Beispiel auf unser Klima.
Wenn Dr. Steffen Kolb von »Senken und Quellen« spricht, meint er damit nicht die geografische Form des Geländes oder den Ursprung eines Gewässers. Eine Senke, so erklärt Kolb, ist immer dort, wo ein Stoff gespeichert oder verbraucht wird – etwa Kohlendioxid in Moor- und Waldböden. Eine Quelle ist genau das Gegenteil. Ein Milchviehbetrieb zum Beispiel ist eine Methanquelle, denn in den Mägen der Kühe entstehen große Mengen des Gases. Es ist längst bekannt, dass Methan den Klimawandel antreibt. Es ist das zweitwichtigste Treibhausgas, obwohl sein Anteil an der Atmosphäre weniger als 0,002 Prozent beträgt. Doch die Verbindung trägt zu etwa 17 Prozent zum Klimawandel bei und ist damit rund 27-mal so wirksam wie Kohlendioxid.
Treibhausgas und Wolkenbildner
Methan ist nur eines von tausenden sogenannten Spurengasen in der Atmosphäre.
Das Verblüffende: Bisher ist wenig über ihre Wirkung bekannt. Einige
regen die Wolkenbildung an und andere sind am Ozonaufbau und am Klimawandel
beteiligt. Doch wie die Gase entstehen, wie sie innerhalb der Stoffkreisläufe
umgewandelt und schließlich wieder abgebaut werden – viele dieser Fragen
sind heute noch offen. Klar ist bisher nur eines: Mikroorganismen, die im Boden
und auf Pflanzen leben, spielen dabei eine zentrale Rolle.
Steffen Kolb nimmt genau diese Organismen genauer unter die Lupe.
Bakterien und Pflanzen betrachtet er dabei nicht als getrennte Systeme. Für ihn
bilden diese Lebewesen enge Gemeinschaften, die voneinander abhängen und
sich gegenseitig beeinflussen. »Symbiome« nennt er sie. Während die Pflanze
etwa flüchtige Verbindungen über ihre Blätter ausscheidet, nutzen die darauf
sitzenden Mikroorganismen genau diese Substanzen, um sich von ihnen zu
ernähren. Im Gegenzug liefern sie der Pflanze Wasser und Nährstoffe.
Kolb und andere Forschende sind sich sicher: Die Landnutzung durch
den Menschen beeinflusst diese Gemeinschaft von Pflanze und Mikroorganismen
signifikant − und damit auch die Freisetzung von Spurengasen. Düngung,
Bodenbearbeitung, Fruchtwechsel, aber auch das Wetter oder die Art der Bewässerung
– es gibt zahlreiche Faktoren, die darüber entscheiden, ob das genutzte
Land Quelle oder Senke für bestimmte Spurengase ist. »Auf einem Ackerfeld
ist die Bilanz anders als in einem Wald«, sagt Kolb. Eine Maismonokultur
beherbergt andere Mikroorganismen als eine Buche in einem intakten Wald.
Und selbst ein Kiefernwald ist nicht mit einem Buchenwald zu vergleichen, wenn
es um die Stoffbilanz der Gase geht.
Welche Gase in welchen Konzentrationen unterschiedliche Kulturpflanzen und
ihre winzigen Lebenspartner bilden, untersucht Kolb mit seinem Team unter
anderem mithilfe von zylinderförmigen Behältern, sogenannten Inkubationskammern,
die im hauseigenen Gewächshaus des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung
(ZALF) e. V. stehen. In diesen luftdicht verschließbaren
Röhren, in denen einzelne Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen wachsen,
können Gase gezielt zu- und abgeführt werden. So lässt sich genau analysieren,
welche Emissionen zum Beispiel während des Wachstums entstehen.
Unterschätzte Partnerschaft
Um diese Beobachtungen auch in größerem Maßstab und für ganze Agrarökosysteme
durchzuführen, arbeiten die Forschenden im Freiland mit sogenannten
Gashauben. Die bis zu vier Meter hohen Konstrukte aus transparentem Plastik
stülpen sie über die Kulturpflanzen und messen die Gaskonzentrationen im
Inneren. So erhalten sie Daten über den gesamten Jahresverlauf und können
errechnen, in welcher Jahreszeit oder mit welchen Kulturpflanzen besonders
viele Treibhausgase wie Methan, Lachgas oder Kohlendioxid gebildet oder eben
verbraucht werden.
Kolb und sein Team wollen aber nicht nur messen, sondern auch
die biologischen Treiber dieser Prozesse verstehen – nämlich jene Systeme,
die er als »Symbiome« bezeichnet: die ökologische Einheit zwischen Pflanze und Mikroorganismen. Dabei stehen sie vor einer schier unfassbaren Vielfalt:
»In einem Gramm Boden sind locker 20.000 verschiedene Mikroorganismenarten
«, erklärt er. Bei deren Analyse hilft die Molekularbiologie: Aus Bodenund
Pflanzenproben bestimmen die Forschenden nicht nur, welche Arten
von Bakterien, Pilzen, Hefen und Pflanzen vorkommen. Mit ausgeklügelten
Methoden spüren sie in Laborversuchen auch auf, welche Organsimen welche
Gase nutzen oder bilden und ob Stress wie Hitze oder Trockenheit die Emissionsmuster
verändern.
»Zwischen Pflanzen und Mikroorganismen gibt es Interaktionen, die
wir völlig unterschätzen«, betont Kolb. Der Forschungsbedarf ist entsprechend
groß – zumal das empfindliche Gleichgewicht der Atmosphäre von diesen
Wechselwirkungen bestimmt wird. »Wir beeinflussen dieses System ständig,
ohne genau zu wissen, wie sich das auswirkt«, mahnt der Forscher. Seine Forschung
im »Kleinen« ist ein wichtiges Puzzleteil für die Lösung großer Fragen.
So wichtig sogar, dass noch in diesem Jahr am ZALF mit dem Bau des »Hauses
der Kulturbiomforschung« begonnen wird, um die Lebensgemeinschaften von
Kulturpflanzen und Mikroorganismen in Zukunft noch besser zu verstehen.
Text: Heike Kampe
Infomaterial und weiterführende Informationen: