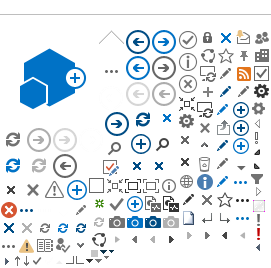26.01.2024

Neue Flächenansprüche für Siedlungen, Verkehr, Wald, Naturschutz und zunehmend auch für erneuerbare Energien wie Freiflächenphotovoltaik oder neue Kohlenstoffsenken durch Wiedervernässung von Mooren verstärken die ohnehin bestehenden Flächennutzungskonkurrenzen für die Landwirtschaft. Gleichzeitig stehen wir vor der Transformation hin zu nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen. Hierbei soll die Agrarökologie als ein ganzheitlicher sozial-ökologischer Innovationspfad von Politik, Wissenschaft und Praxis verstärkt Berücksichtigung und Förderung erfahren.
Im hybriden Fachgespräch „Ernährung sichern – agrarökologisch, pflanzenbasiert, regional“ diskutierten anlässlich der „Grünen Woche“ am 19. Januar 2024 Mitglieder der Fraktion „die Grünen“ im Bundestag mit Expertinnen und Experten die Frage: Wie schaffen wir den agrarökologischen Umbau kurz-, mittel- und langfristig? Dr. Annette Piorr, Leiterin der ZALF-AG Landnutzungswandel im Raum- und Systemkontext, wurde zu den Chancen und Risiken eines agrarökologischen Umbaus für den potenziellen Selbstversorgungsgrad Deutschlands und Europas befragt sowie zu der Frage, wie man angesichts der wachsenden Flächenkonkurrenzen bei gleichzeitiger Etablierung agrarökologischer Prinzipien das meiste aus den Flächen machen kann, die uns zur Verfügung stehen.
„Modellbasierte Studien, auch aus dem ZALF, belegen, dass eine Selbstversorgung mit einem breiten Produktportfolio selbst bei ökologischem Landbau möglich ist. Letztendlich sind diese Studien aber in erster Linie geeignet, Potenziale aufzuzeigen, die man mit der Realität abgleichen muss. Sie helfen, Ansatzpunkte und Pfade für den Umbau zu erkennen. Und dazu gehört, dass ein Umbau des Agrar- und Ernährungssystems Hand in Hand gehen muss. Auf der einen Seite benötigt die Ökologisierung der Anbaumuster mehr Fläche. Diese Flächenpotenziale können wir auf der anderen Seite durch einen Umbau der Tierhaltung freisetzen und tierische Proteine teilweise durch pflanzliche ersetzen“, so Frau Piorr.
„Um sicherzustellen, dass bestehende Flächen auch zukünftig zur Verfügung stehen, gibt es viele Instrumente aufseiten der Länder, aber auch insbesondere aufseiten der Kommunen. Die Ausweisung von Vorranggebieten für Landwirtschaft, Bodenfonds oder Vergabesysteme für die Pacht aus öffentlichen Landbesitz gehören dazu. Wenn wir die Flächen dann auch nachhaltig nutzen wollen, können mit Agrarökologie als Systemansatz tatsächlich Effizienzsteigerungen realisiert werden. Über fünf Stufen erfolgt die Transformation, beginnend bei Bodenaufbau und Diversifizierung, was Stabilität und mittelfristig auch Kostensenkungen durch Stärkung systemischer Selbstregulation bedingt. Eine große Chance liegt darin, nachhaltige Systemansätze von der Ebene des Einzelbetriebes auf Landschaftsebene zu bringen, in regionale Wertschöpfungsketten, und auch in Strategien die bis zum Ernährungsverhalten, z. B. in der Gemeinschaftsverpflegung reichen, und über die Vermeidung von Lebensmittelabfällen indirekt auch wieder Flächenpotenziale effizienter nutzt. Ganz wichtig ist hier, dass wir geeignete Strukturen etablieren, die den Dialog zur Findung gemeinsamer Lösungswege in Abwägung der natürlichen und sozio-ökonomischen Bedingungen ermöglichen. Hier bietet Agrarökologie einen zukunftsweisenden Pfad, der letztendlich zeigt: Die Transformation des Agrar- und Ernährungssystems wird in erster Linie regional gelingen und nur unter Einbindung vieler Akteure.“
Das ZALF forscht in diesem Sinne bereits in mehreren Projekten systemisch an der agrarökologischen Transformation und ist mit der Beteiligung an der europäischen Partnerschaft für agrarökologische Reallabore und Forschungsinfrastrukturen auf dem Weg, diese Forschung zukünftig auszuweiten.
Weitere Informationen: