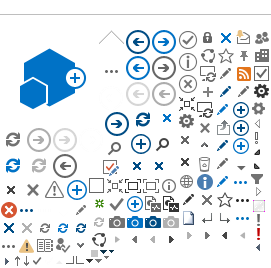15.05.2024

Am 8. Mai 2024 eröffnete Frau Dr. Vera Grimm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das zweite Nationale Forum Agri-PV mit dem Titel „Agri-PV: Bisherige Erfahrungen bei Genehmigung und Betrieb“, zu dem das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) und Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in das Fraunhofer-Forum Berlin einluden.
An die 100 Gäste, darunter Akteure und Verbände aus Land- und Energiewirtschaft, Naturschutz, Kommunen und Planung und Vertreterinnen und Vertreter aus Ministerien und Bundesbehörden, Politik sowie Wissenschaft und Forschung nahmen an der Veranstaltung teil. Das Event fand im Rahmen des vom BMBF geförderten Forschungsprojektes „SynAgri-PV: Synergetische Integration der Photovoltaik in die Landwirtschaft als Beitrag zu einer erfolgreichen Energiewende – Vernetzung und Begleitung des Markthochlaufs der Agri-PV in Deutschland“ statt.
Inhalte des zweiten Nationalen Forums Agri-PV
Wie beim ersten Nationalen Forum Agri-PV war auch beim zweiten eines der Ziele, Akteursgruppen zu vernetzen und einen praktischen Erfahrungsaustausch zwischen diesen zu ermöglichen.
Mit dem nationalen Forum Agri-PV wird ein dauerhaftes Austauschformat etabliert, bei dem aktuelle Themen zu Agri-PV regelmäßig diskutiert werden – stets unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Forschung und Entwicklung von Agri-PV in Deutschland. Ein solches Format gab es in Deutschland bisher nicht.
Die Veranstaltung startete einführend mit einem Überblick zu aktuellen Fragestellungen zur Agri-PV. Jun.-Prof. Dr. Andreas Schweiger der Universität Hohenheim zeigte die Potenziale und Grenzen von Agri-PV für den Ackerbau auf, Sandra Dullau von der Hochschule Anhalt und Dr. agr. Bernd Günther von Heide Solar teilten ihre Erfahrungen mit Wildpflanzenstreifen und ihr Wissen über den Einfluss der Anlagen auf die Bodenfeuchte. Dr. Dieter Günnewig der Bosch & Partner GmbH informierte über Biodiversitäts-PV und extensive Formen der Agri-PV und Lisa-Marie Bieber vom Fraunhofer ISE über den Stand der DIN SPEC-Prozesse – einschließlich ihrer Chancen und Risiken für den Markthochlauf.
Der Praxischeck zu Genehmigungspraxis, Agri-PV im Obstbau und Aspekte der Wirtschaftlichkeit
Der Schwerpunkt des zweiten Expertentreffens lag bei der Genehmigungspraxis und dem Betrieb von Agri-PV-Anlagen. In Fachworkshops wurden die bisherigen Erfahrungen der Expertinnen und Experten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Agri-PV vertieft, um weitere gesellschaftlich akzeptierte aber auch umsetzbare Lösungen für den Markthochlauf von Agri-PV zu entwickeln.
Das BMBF fördert seit 2014 Forschung zur Agri-PV, da diese eine smarte Flächennutzung ermöglichen und dazu beitragen, Flächen zu sparen sowie Normierungsaktivitäten. Frau Dr. Vera Grimm vom BMBF wies in ihrer Begrüßungsrede auf die Bedeutung von Pilotprojekten hin, da diese Erkenntnisse für die Gesetzgebung liefern. Aktuelle Forschungsergebnisse sorgen für eine Entwicklung einer klaren Definition der Agri-Photovoltaik, denn diese spielt eine entscheidende Rolle bei der Abgrenzung zu den Freiflächenanlagen.
Im Workshop „Genehmigungspraxis“ mit Jens Vollprecht, Partner bei Becker Büttner Held (BBH), ging es um die positiven und negativen Erfahrungen, die bisher in der Planung, Genehmigung und den Betrieb von Agri-PV-Anlagen gemacht wurden. In der Gruppe wurden Beispiele genannt, bei denen die kürzlich eingeführte baurechtliche Privilegierung von hofnahen Anlagen zu einer deutlichen Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens führte. Damit scheint die Privilegierung schon wirksam zu werden. Bisher stellten die langen und aufwändigen Planungs- und Genehmigungsprozesse aus Sicht von Landwirtinnen und Landwirten und Projektentwicklerinnen und -entwicklern ein Hemmnis dar.
Kontrovers diskutiert wurde das Spannungsfeld zwischen dem Solarausbau und dem Schutz von Natur und Landschaft. Offene Fragen berührten u. a. die Bemessung der tatsächlichen Bodenversiegelung durch Agri-PV-Anlagen und damit verbunden die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Teilnehmenden berichteten außerdem, dass die Auswirkungen auf Flora und Fauna schwierig zu bewerten seien, da der Standort, die landwirtschaftliche Nutzung und die Konfiguration der Anlagen einen hohen Einfluss haben.
Antonia Kallina von der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl und Gregor Beyer vom Amt für Landwirtschaft und Umwelt des Landkreises Märkisch-Oderland gaben den Auftakt für die Diskussion im Workshop. Gregor Beyer gab einen praktischen Einblick in den Arbeitsalltag einer Genehmigungsbehörde in Brandenburg und stellte die einzelnen Prüfschritte vor. Antonia Kallina griff in Ihrem Vortrag das Thema Privilegierung auf und erläuterte praktische baurechtliche Fragestellungen. Am Beispiel der Gemeinde Oberkirch in Baden-Württemberg stellte sie ein informelles Planungskonzept vor, bei der die Gemeinde die Nutzung von Flächen für Freiflächen und Agri-PV-Anlagen versucht, aktiv zu steuern.
Insgesamt zeigte sich, dass Agri-PV sehr viele verschiedene Rechtsbereiche berührt, was die Planung, Genehmigung und den Betrieb recht komplex macht. Von den Teilnehmenden wurde eine sachbezogene Betrachtung angeregt und dafür geworben, nach Lösungen und nicht nach Problemen zu suchen. Wichtig sei es, klar zu definieren, was genau eine Agri-PV-Anlage ist und was nicht und dieses Wissen mit anderen Akteuren zu teilen, damit alle auf dem jeweils aktuellen Stand von Forschung, Technik und Rechtsprechung sind. Eine Möglichkeit hierfür bietet der kommunale Leitfaden Agri-PV, den die Hochschule Kehl derzeit erarbeitet.
Die Teilnehmenden des zweiten Workshops befassten sich mit Best-Practice-Beispielen aus dem Obstbau. Hierfür wurden Landwirtin Sina Bernhard (Obsthof Bernhard) und Jürgen Zimmer von den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR-RLP) eingeladen. Oliver Hörnle vom Fraunhofer ISE fasste die bisherigen Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen: “Was sich bereits als positiv erweist, ist der Temperatur-Effekt unter der Agri-PV-Anlage. Das heißt, wir messen an kalten Tagen wärmere Temperaturen und an heißen Tagen kühlere. Daraus ergeben sich Wasser- und Bewässerungseinsparungen und das natürliche Wasser kann besser verwertet werden. Und auch die Mittelwirksamkeit kann erhöht werden, da die Pflanzenschutzmittel durch die geringere Abwaschung und geringere Sonnenexposition länger auf der Pflanze bleiben.“ Agri-PV ist besonders geeignet für Obstanbau, der in Reihen erfolgt und einen Stützbedarf hat.
Doch auch die Hemmnisse wurden unter die Lupe genommen, wie z. B. die mögliche ungleichmäßige Wasserverteilung unterhalb der Module durch die Konzentrationen von Wasser an den Abtropfkanten, die verschiedenen Bedürfnisse unterschiedlicher Sorten, weshalb keine klaren Empfehlungen für alle Obstbauanwendungen gegeben werden können. Diskutiert wurden außerdem ökologische Ausgleichsmaßnahmen sowie das Solarpaket I.
Welche Kulturen und Sorten sich am besten eignen oder wie sichergestellt werden kann, dass Landwirte in dem Bereich nicht benachteiligt sind und wie Agri-PV-Anlagen gefördert werden können, wurden als offene Fragen für den Obstbau identifiziert. Weiterhin wurden die Modulkühlung oder die Verschmutzung durch Spritzmittel thematisiert.
Die Aspekte der Wirtschaftlichkeit von Agri-PV-Anlagen wurden in einem dritten Workshop erörtert, den Carl Pump moderierte. Impulse gab es hier von Jonas Böhm vom Thünen-Institut, der die Wirtschaftlichkeit verschiedener Agri-PV Konzepte wie unter anderem die Standard PV-Freiflächenanlagen, vertikale, trackergeführte oder hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlagen vorstellte. Freya von Loeper von der Elysium Solar GmbH informierte die Teilnehmer über Agri-PV-Geschäftsmodelle. Schwerpunkt hierbei bildeten die verschiedenen Betreiberkonzepte, Rollen und Vertragsstrukturen sowie die Mehrwerte.
Anschließend arbeiteten die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer die Aspekte heraus, die die Wirtschaftlichkeit von Agri-PV-Anlagen am stärksten beeinflussen.
Aus der Vielzahl an identifizierten Aspekten wurden fünf entscheidende herausgearbeitet: der Netzanschluss, die Ausgleichsmaßnahmen, Größe der Anlagen, Zinsen und Anlagenentwicklung. Zudem wurden die Vor- und Nachteile von Bürgerbeteiligungsmodellen diskutiert. Die Diskussion zu den Hemmnissen beinhaltete unter anderem die Flächennutzungsplanänderungen, Gutachten und Nachweispflichten. Problematisch erwies sich bisher ebenso der unterschiedliche Kenntnis- und Wissensstand zu gewissen Prozessen in den einzelnen Behörden bei vielen beteiligten Akteuren. Alle Teilnehmer waren sich bezüglich der im Workshop erwähnten Punkte einig.
Abschließend ordnete Jens Vollprecht (BBH) die Ergebnisse der Workshops mit Bezug auf das Solarpaket I ein.
Projektpartner:
- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)
- Universität Hohenheim - Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie
- Elysium Solar GmbH
- Becker Büttner Held Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater PartGmbB (BBH)
- Stiftung Umweltenergierecht
- Bosch & Partner GmbH
Förderhinweis:
Das Projekt SynAgri-PV wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Infomaterial und weiterführende Informationen: