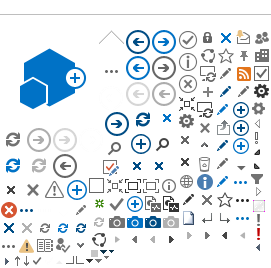13.02.2025

Als Projektpartner des WetNetBB war das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) auf der diesjährigen Internationalen Grünen Woche vom 17. bis 26. Januar 2025 vertreten. Das Projekt WetNetBB untersucht die Synergiepotenziale von Mooren im Klima-, Wasser-, Boden- und Biodiversitätsschutz sowie deren wirtschaftliche Perspektiven. Ziel ist es, die Akzeptanz und das Interesse an einer nachhaltigen Moornutzung zu fördern und geeignete institutionelle Rahmenbedingungen zu identifizieren. Ein Forschungsteam des ZALF ist mit den Besucherinnen und Besuchern der Grünen Woche 2025 ins Gespräch gekommen und hat sie zu ihrer Meinung zur landwirtschaftlichen Nutzung von Mooren befragt.
Die Arbeitsgruppe „Governance von Ökosystemleistungen“ am ZALF begleitet das Projekt wissenschaftlich, mit einem Fokus auf sozioökonomische Fragestellungen. Ein zentrales Thema ist die Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle für die Nutzung wiedervernässter Moorflächen. Vor diesem Hintergrund hat das Forschungsteam auf der Grünen Woche eine Umfrage durchgeführt, die sich mit zwei zentralen Fragestellungen befasste:
- Sollte das Prinzip der Freiwilligkeit gewahrt bleiben, so dass Landwirtinnen und Landwirte selbst über die Wiedervernässung ihrer Flächen entscheiden können?
- Welche finanziellen Anreize sind geeignet, um Landwirtinnen und Landwirte zur Umstellung auf Paludikultur zu motivieren?
Paludikultur beschreibt die landwirtschaftliche Nutzung wiedervernässter Moorflächen, beispielsweise durch den Anbau von Schilf oder Rohrkolben für Baustoffe und Verpackungsmaterialien.
Die Umfrage wurde über einen QR-Code am ZALF-Messestand verteilt und von 62 Personen ausgefüllt. Die Teilnehmenden setzten sich überwiegend aus Verbraucherinnen und Verbrauchern (70%) aus Berlin-Brandenburg (73%) zusammen, wobei die Altersgruppe 25-39 Jahre (49%) am stärksten vertreten war.
Zentrale Ergebnisse:
- Zur Frage, ob die Wiedervernässung freiwillig bleiben sollte, zeigten sich zwei Gruppen: 44% befürworteten das Prinzip der Freiwilligkeit, während 37% es ablehnten.
- Bei den wirtschaftlichen Anreizen wurden öffentliche Zahlungen für Ökosystemleistungen (wie CO₂-Speicherung) in beiden Gruppen als bevorzugte Maßnahme genannt (89% bzw. 91%).
- Unterschiede zeigten sich insbesondere bei der Besteuerung von Emissionen: Während 81% der Gruppe, die die Freiwilligkeit ablehnt, eine solche Steuer unterstützten, waren es in der anderen Gruppe nur 56%. Ebenso bei den zeitlich begrenzten staatlichen Subventionen: Während 74% der Gruppe, die die Freiwilligkeit bevorzugt, den zweiten Rang einnahmen, erreichte die Gruppe der Unfreiwilligkeit mit 68% eher den fünften Rang. •
- Als zentrale Argumente für die Wiedervernässung wurden CO₂-Reduktion (32%) und die Förderung der Biodiversität (25%) hervorgehoben, während Einkommensverluste und der Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen (33%) als Haupteinwände genannt wurden.
Diese Erkenntnisse bieten ein Stimmungsbild für die Weiterentwicklung von Förderinstrumenten zur nachhaltigen Nutzung von Moorlandschaften. Ein intensiverer Austausch mit relevanten Akteuren sowie weiterführende wissenschaftliche Forschung sind erforderlich, um fundierte und belastbare Aussagen treffen zu können.
Weitere Informationen: