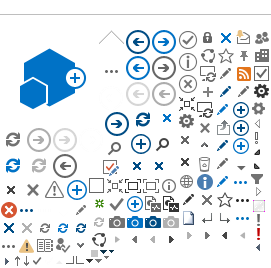26.09.2024

Ein internationales Forscherteam unter Beteiligung von Experten aus dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) hat die Performance von vielfältigen Fruchtfolgen, die unter Mitgestaltung lokaler Akteure entwickelt wurden, im Vergleich zu kontinuierlichem Getreideanbau im mediterranen Raum untersucht. Die Ergebnisse, die im “European Journal of Agronomy“ veröffentlicht wurden, zeigten sowohl agronomische als auch ökonomische Leistungsverbesserung bei der Integration von einzelnen Leguminosen in die Fruchtfolgen. Die Integration von Raps oder mehreren Leguminosen wies jedoch unterschiedliche Wirkungen auf. Es handelt sich um eine der ersten Studien in der Region, die partizipatorische Ansätze und Modellierungsmethoden kombiniert. Dabei legen die Autoren besonderen Wert auf die Einbeziehung von Interessengruppen in die Planung und Bewertung von Fruchtfolgen. Die Kombination von Modellierungsmethoden und partizipativen Ansätzen ermöglicht es, die Landwirte über praktische Optionen zu informieren, die ihnen in ihrem Streben nach einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Landwirtschaft zur Verfügung stehen.
Das Forschungsteam, bestehend aus Forschenden aus Spanien, Frankreich und Deutschland, konzentrierte sich auf das Ebro Tal in Spanien, eine Region mit schwierigen klimatischen Bedingungen und Bodenverhältnissen. Um praktische Lösungen zu entwickeln, arbeiteten die Forscher eng mit Landwirten und anderen relevanten lokalen Akteuren zusammen.
In einem ersten Workshop wurden bestehende Anbausysteme und deren Herausforderungen identifiziert. Optionen für eine Diversifizierung der Anbausysteme wurden in einem partizipativen Ansatz gemeinsam mit lokalen Akteuren entwickelt. In einem zweiten Workshop bewerteten die Akteure die diversifizierten Systeme basierend auf den Modellierungsergebnissen. Die neuen diversifizierten Systeme setzen auf Fruchtfolgen von Getreide, in die alle 2 oder 4 Jahre Leguminosen und/oder Raps integriert werden. Die Bodenbearbeitung ist reduziert, die syntheti-schen Stickstoff-Düngung (N) wird teilweise durch lokal gewonnenen Schweinemist ersetzt. Mit dem eindimensionalen Boden-Pflanzen-Modell STICS simulierten die Forschenden die tägliche agronomische und ökologische Leistung der neu entwickelten Anbausysteme über einen Zeitraum von 21 Jahren, um ihre langfristige Wirkung und ihre Reaktion auf die zunehmende Klimavariabilität zu bewerten. Auch eine wirtschaftliche Leistungsbewertung wurde durchgeführt.
Diversifizierung: die Abwägung zwischen agrar-ökologischen und sozio-ökonomischen Auswirkungen
Stickstoff-Überschüsse aus Gülle sind im Ebro-Tal in Spanien reichlich vorhanden und erfordern ein angemessenes Management, um Umweltrisiken (z.B. Kontamina-tion des Grundwassers) zu minimieren. Der Ersatz von mineralischem Stickstoff durch Gülle in den diversifizierten Systemen und die Integration von Leguminosen, die in der Lage sind, biologischen Stickstoff zu fixieren, hat zu einer Zunahme des verfügbaren mineralisierten Stickstoffs geführt. “Erbsen haben die Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft in ihren Wurzeln zu fixieren und so den Pool des verfügbaren Stickstoffs für die nachfolgenden Kulturen zu erhöhen“, erklären Ferdaous Rezgui und Genís Simon-Miquel, Co-Autoren der Studie und Wissenschaftler in der Arbeitsgruppe „Ressourceneffiziente Anbausysteme“ am ZALF. Im Gegenzug kann Raps tiefere Bodenschichten durchwurzeln und den dort verfügbaren Stickstoff aufnehmen, der für andere Kulturen nicht zugänglich ist. Ein großartiges Beispiel für Nischenkomplementarität durch Kulturdiversifizierung.
Allerdings brachte die Kulturdiversifizierung auch unerwartete Umweltprobleme mit sich. Zum Beispiel beobachteten die Forscher erhöhte Stickstoffverluste in den diversifizierten Systemen durch das Verdampfen von Ammoniak und Nitrat-Auswaschung, da im Boden reichlich verfügbarer Stickstoff vorhanden war. Die Getreideerträge von Weizen und Gerste blieben mit der Diversifizierung stabil. Erbsen- und Rapserträge waren höher, wenn sie separat in die Fruchtfolge integriert wurden, anstatt kombiniert. Die Energieerträge sanken um 20 Prozent, wenn Erbsen und Raps in derselben Fruchtfolge eingeführt wurden, und um 10 Prozent, wenn sie separat eingeführt wurden.
Aus wirtschaftlicher Sicht zeigten die diversifizierten Systeme gemischte Ergebnisse. Während das System Weizen-Erbse-Weizen-Gerste den Bruttogewinn um 12 % steigern konnte, sanken die Gewinne in anderen Systemen oder blieben unverändert. Allerdings führte der Einsatz von Gülle in den diversifizierten Systemen zu erheblichen Einsparungen bei den Düngungskosten durch die Reduzierung des mineralischen Stickstoff-Einsatzes. Für das System mit Erbsen wurden Einsparungen von 68 % im Vergleich zum Referenzsystem, einer Getreide-Monokultur, erreicht. Die Ergebnisse dieser Studie können als Grundlage für die Verfeinerung und Gestaltung geeigneterer Diversifizierungsoptionen in der Region dienen.
Projektpartner:
- Universitat de Lleida, Agrotecnio-CERCA Center (Spanien)
- Innovation, Université Montpellier, CIRAD, INRAE, Institut Agro (Frankreich)
- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) (Deutschland)
Förderhinweis:
Diese Arbeit wurde durch die Spanische Agentur für Forschung (Förderung PCI2020–112297, finanziert von MCIN/AEI/10.13039/501100011033 und der Europäischen Union Next Generation EU/PRTR) im Rahmen der PRIMA Foundation, Aufruf 2019-Section 2–BIODIVERSIFY, ein Programm der Europäischen Union, gefördert. Weitere Unterstützung erhielt das Projekt durch das SusCrop-ERANET LegumeGap-Projekt, PCI2019–103597, finanziert durch MCIN/AEI/10.13039/5011 00011033, co-finanziert von der Europäischen Union sowie durch das ECO-TRACE Forschungsprojekt, TED2021–131895A-I00, gefördert von MCIN/AEI/10.13039/5 01100011033 und der Europäischen Union NextGenerationEU/PRTR. Daniel Plaza-Bonilla ist Ramon y Cajal Fellow (RYC-2018–024536-I), co-finanziert durch MICIN /AEI/10.13039/501100011033 und den Europäischen Sozialfonds. Louise Blanc wurde durch einen Universitätsvertrag der Universität von Lleida gefördert. Laure Hossard wurde von der ANR (Fördernummer: ANR-19-P026–0008–01) gefördert. Ferdaous Rezgui wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Deutschland (Fördernummer 01DH20014), im Rahmen der PRIMA Foundation, Section 2 Call 2019 - Multi-topic gefördert.