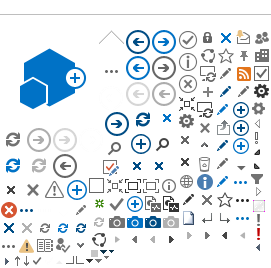21.06.2024

Ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), des Instituts für Technologie- und Ressourcenmanagement in den Tropen und Subtropen (ITT) der TH Köln, des Instituts für Umweltwissenschaften und Geographie der Universität Potsdam sowie des Instituts für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES) der Universität Bonn hat in einer Studie mithilfe von modernen, digitalen Sensoren den Einfluss von Pflanzen und Böden auf Bodenfeuchte untersucht. Die in der Studie vorgestellte Methode kann in der weiteren Forschung dazu beitragen, die Einflussfaktoren auf die Bodenfeuchte besser zu verstehen. Dies ist für die Entwicklung wassereffizienterer Anbaumethoden wichtig. Die Ergebnisse wurden jetzt in der Fachzeitschrift „Hydrology and Earth System Sciences" veröffentlicht.
In der Studie analysierten die Forschenden 64 Bodenfeuchte-Zeitreihen eines diversifizierten Feldes mit sieben verschiedenen Kulturen und zwei Unkrautmanagementstrategien. Die Ergebnisse zeigten, dass etwa 97 % der räumlichen und zeitlichen Schwankungen in der Bodenfeuchte durch fünf Hauptkomponenten erklärt werden können. Wetterbedingte Faktoren erklärten 72,3 %. 17,0 % wurden dem unterschiedlichen saisonalen Verhalten der Kulturen zugeschrieben. Die Bodentextur war zu 4,1 %, und das Anbausystem für nur 2,2 % der Abweichungen ursächlich. Die Bodentiefe der Messung hat lediglich einen Einfluss von 1,7%. Damit lassen sich 19,2 % der Veränderungen der Bodenfeuchte durch pflanzenbezogene Faktoren erklären. Nur 5,8% sind auf Bodeneigenschaften zurückzuführen.
Zur Überraschung der Forschenden hatten weder die Topographie des Geländes noch die Unkrautbekämpfungsstrategie einen signifikanten Einfluss. Auch die Boden- und Wurzelheterogenität seien vernachlässigbar, so die Autorinnen und Autoren. Die Ergebnisse seien zwar stark standortabhängig, der vorgestellte Ansatz zur statistischen Auswertung von Zeitreihen allerdings auf eine Vielzahl von Bedingungen übertragbar.
LoRaWAN-basierte Sensornetze
Innerhalb der Studie nutzen die Forschenden sogenannte LoRaWAN-basierte drahtlose Sensornetzwerke, eine fortschrittliche Technologie zur kabellosen Überwachung der Bodenfeuchte. Diese Netzwerke ermöglichen die Übertragung von Daten über große Entfernungen bei geringem Energieverbrauch. Sensoren im Boden messen kontinuierlich die Feuchtigkeit in verschiedenen Tiefen und senden die Daten in Echtzeit an zentrale Datenbanken. Dies ermöglicht eine genaue und kontinuierliche Überwachung der Bodenbedingungen.
Das patchCROP-Landschaftsexperiment
Die Untersuchungen fanden im Rahmen des Landschaftsexperiments patchCROP in Tempelberg, Brandenburg, statt. Das Experiment untersucht, welche Auswirkungen eine räumliche und zeitliche Diversifizierung im Anbau auf Bodengesundheit, Wasserverfügbarkeit, Ertrag, Biodiversität und Pflanzenschutzmitteleinsatz haben.
„Unsere Forschung zeigt, wie wichtig das Verständnis über die Wechselwirkungen zwischen Bodenbeschaffenheit und Pflanzenarten sind, um die Bodenfeuchte besser zu verstehen“, erklärt Kathrin Grahmann, eine der leitenden Forscherinnen der Studie. „Mithilfe moderner Sensorik werden wir künftig in der Lage sein, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu entwickeln, um die Wassernutzung weiter zu optimieren.“
Projektpartner:
- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)
- TH Köln
- Universität Potsdam
- Universität Bonn
Förderhinweis:
Diese Forschungsarbeit wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie Deutschlands (EXC 2070: PhenoRob; Projektnummer 390732324) gefördert.