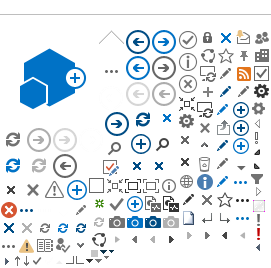24. März 2025
Eine neue Studie, die in Hydrology and Earth System Sciences veröffentlicht wurde, hat den Verlauf der Wasserspeicherung über einen Zeitraum von acht Jahren an zwei klimatisch unterschiedlichen Standorten in Deutschland bei gleichem Boden untersucht. Die Ergebnisse zeigen, wie sich der Bodenspeicher den veränderten Niederschlags- und Verdunstungsbedingungen anpasst. Nach länger andauernden Dürreperioden konnte sich der Wasserspeicher der Böden über Jahre hinweg nicht vollständig wieder auffüllen, so dass im Frühjahr nicht mit dem bodentypischen Wasservorrat gerechnet werden kann. Das bedeutet, dass solche Trockenperioden nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum und die Ernteerträge haben können. Am wärmeren Standort konnten die Forschenden beobachten, dass sich der Einfluss einer früher einsetzenden Vegetationsperiode auf den Bodenwasserspeicher auswirkt.
Böden haben einen Porenraum, in dem sie unterschiedlich viel Wasser speichern können. Je nach Region weisen die Wasserspeicher von Ackerböden dabei typische zeitliche Muster auf: In unseren Breiten füllt sich der Wasserspeicher im Winter auf. Während der Vegetationsperiode, also von Frühjahr bis Herbst, nimmt er durch die Verdunstung wieder ab. Unklar ist, wie sich unterschiedliche klimatische Bedingungen auf diese Muster der Wasserspeicherung in Böden auswirken.
Die Forschenden arbeiteten zu diesem Zweck im Rahmen des deutschlandweiten Lysimeternetzwerkes TERENO-SOILCan (TERrestrial ENvironmental Observatories) an zwei klimatisch unterschiedlichen Standorten in Deutschland: Dedelow in Brandenburg, das durch ein relativ trockenes, kontinentales Klima charakterisiert ist, und Selhausen in Nordrhein-Westfalen, das ein wärmeres und feuchteres Klima aufweist.
Am trockenen Standort Dedelow wurden intakte, zylinderförmige Bodenblöcke mit einer Fläche von einem Quadratmeter und einer Tiefe von 1,5 Metern entnommen. Ihre natürliche Schichtung blieb dabei vollständig erhalten. Die Blöcke wurden an den Standorten Selhausen und Dedelow in Lysimeter eingesetzt. Das sind spezielle Messbehälter, die den kompletten Bodenwasserhaushalt präzise erfassen. So wussten die Forschenden zu jedem Zeitpunkt, wieviel Wasser in Form von Niederschlägen auf den Boden fiel und versickerte bzw. durch Verdunstung oder Drainage auch wieder abgegeben wurde. Mittels Zeitreihenanalysen von 2014 bis 2021 konnten die Forschenden nun analysieren, wie sich die Bodenwasserspeicherung über Jahre veränderte. Die landwirtschaftliche Nutzung und die Bodenbearbeitung blieben auf den Flächen dabei immer gleich. Das lieferte entscheidende Hinweise auf die Reaktion des Wasserhaushalts der Böden auf die klimatischen Bedingungen in diesem Zeitraum.
Gleicher Boden an unterschiedlichen Standorten: Wie unterscheiden sich die Reaktionen auf Niederschlag?
Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Boden an den beiden Standorten unterschiedlich reagiert hat. In Selhausen, wo es wärmer und feuchter ist, verschob sich der Zeitpunkt, wann der Boden maximal viel Wasser speicherte: In niederschlagsreichen Jahren trat dieses Maximum früher, in trockenen Jahren später auf als am trockeneren Standort Dedelow. Das zeigt, dass der Boden in Selhausen dynamischer reagierte. Ebenso konnten anhand der Speicheränderungen deutliche Effekte des früheren Beginns der Vegetation im Frühjahr beobachtet werden. In Dedelow blieben die Muster der Wasserspeicherung über die Jahre hingegen weitgehend stabil. Nach Trockenperioden füllte sich der Bodenwasserspeicher am feuchten Standort aufgrund der höheren Niederschläge schnell wieder auf, während am trockenen Standort in Dedelow die Auswirkungen von langen Trockenphasen auch länger andauerten.
„Unsere Ergebnisse zeigen: Verändern sich die klimatischen Bedingungen, wirkt sich das darauf aus, wie Böden Wasser speichern. Wir haben mit den Zeitreihenanalysen nun eine Grundlage für weiterführende Untersuchungen, beispielsweise zu der Frage, ob sich die Bodeneigenschaften und damit die Wasserspeicherkapazität des Bodens bei Klimaänderungen auch längerfristig verändern können“, erklärt
Dr. Annelie Ehrhardt, Erstautorin der Studie.
Ausblick auf zukünftige Forschung und mögliche Anwendungsfelder
Wie verändert sich der Bodenwasserspeicher langfristig und wie wirkt sich das auf die Landwirtschaft und den Wasserhaushalt aus? Die Forschenden empfehlen eine langfristige Überwachung der Muster der Bodenfeuchte und des pflanzenverfügbaren Bodenwassers. Mit diesem Wissen könnten Landwirtinnen und Landwirte Fruchtfolgen und Anbauverfahren auf ihren Feldern an einen veränderten Bodenwasserhaushalt und eventuell veränderten Bodeneigenschaften anpassen. So könnten sie sicherstellen, dass Wasser für die Pflanzenproduktion zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stünde. Auch wäre denkbar, dass so die Grundwasserneubildung und die Wasserqualität des Bodens optimiert werden könnte.
Projektpartner
- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)
- Universität Bonn
- Forschungszentrum Jülich
Förderhinweis:
Die Forschungsarbeit wurde finanziert durch das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) gefördert wird. Die Datenerhebung wurde dankenswerterweise im Rahmen der von der Helmholtz-Gemeinschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Infrastruktur TERENO-SOILCan durchgeführt. Zusätzlich wurde die Studie durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) unter der Fördernummer 22404117 unterstützt. Jannis Groh wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Projektnummer 460817082) gefördert.
Danksagung:
An dieser Stelle möchten wir unseren aufrichtigen Dank den Mitarbeitern des ZALF, Jörg Haase und Gernot Verch, sowie des Forschungszentrums Jülich, Werner Küpper und Philipp Meulendick, aussprechen. Sie haben den Betrieb der Instrumente und die Datenerhebung an beiden Standorten übernommen.
Weitere Informationen:
https://hess.copernicus.org/articles/29/313/2025/
Hinweis zum Text:
Dies ist eine mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz im ersten Entwurf erstellte Zusammenfassung des Originaltextes: Ehrhardt, A., Groh, J., & Gerke, H. H. (2025). Effects of different climatic conditions on soil water storage patterns. Hydrology and Earth System Sciences, 29(1), 313–334. DOI: 10.5194/hess-29-313-2025, veröffentlicht Open Access unter der Lizenz CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Der Text wurde unter den Gesichtspunkten der KI-Regelungen am ZALF sorgfältig überprüft und überarbeitet.