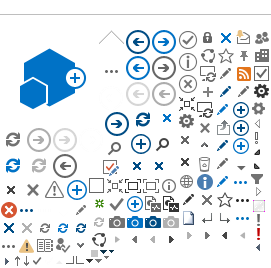Insekten sind für viele Pflanzen auf unseren Feldern und Plantagen unverzichtbar. Neben der Honigbiene kümmert sich eine ganze Armada von Wildinsekten darum, dass Blüten bestäubt werden und aus ihnen Früchte entstehen. Doch sowohl für die Bienenvölker unter der Obhut des Imkers als auch für ihre wilden Verwandten gilt: Ihre Anzahl ist rückläufig. Immer weniger Hummeln, Bienen und Schwebfliegen summen in den Obstbäumen und schwirren über die Felder. Auf der Suche nach Ursachen wurde festgestellt, dass es keine Pauschallösungen gibt, sondern der genauere Blick auf das Ökosystem Acker und seine Umgebung lohnt.
235 bis 577 Milliarden US-Dollar: Das ist die Leistung wert, die Blütenbesucher wie Honig- und Wildbienen, Schmetterlinge, Fledermäuse oder Vögel weltweit pro Jahr erbringen. Sie transportieren den Pollen von einer Blüte zur anderen – ein Service, den die Tiere kostenlos anbieten. Die Sache hat nur einen Haken: Die Zahl der Blütenbestäuber hat in den vergangenen Jahren rapide abgenommen. Viele Arten sind in ihrem Bestand gefährdet, vom Aussterben bedroht oder bereits unwiederbringlich verloren. Nicht nur für den Umweltschutz und die Wissenschaft ist dies ein Grund zur Sorge. Ein Teil unserer Nutzpflanzen bildet ohne Blütenbesuch keine oder deutlich weniger Früchte aus. Sterben die Bestäuber, ist auch die Nahrungsmittelsicherheit gefährdet.
Wie drängend das Problem ist, zeigt sich heute bereits dort, wo es kaum noch wildlebende Blütenbesucher gibt: In einigen Regionen Asiens bestäuben Menschen die Blüten in den Obstplantagen mit dem Pinsel. In Japan und den USA wird an Minidrohnen als Blütenbestäuber gearbeitet. Was kann die Forschung zur Rettung der Bestäuber beitragen, bevor es zu spät ist?
Ein Team des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. und des Johann Heinrich von Thünen-Instituts hat sich auf die Suche nach Antworten begeben. »Es gibt viele verschiedene Ursachen«, erklärt Karoline Brandt. »Die Wechselbeziehungen zwischen den Organismen, ihrer Umgebung, den bewirtschafteten Flächen und der Art der Bewirtschaftung sind komplex.« Fakt ist: Die Liste der Bedrohungen ist lang. Ob Monokulturen, zerstörte natürliche Lebensräume oder Pestizide – in einer intensivierten Landwirtschaft finden die Insekten immer weniger Nahrungs- und Lebensgrundlagen. Ihre Populationen werden geschwächt und sind so zusätzlich anfälliger für Krankheiten und Parasiten. Doch es sei schwierig, einzelne Ursachen genau zu quantifizieren oder präzise Aussagen über ihre Wechselwirkungen zu treffen, sagt Brandt. Denn bisher sind einzelne Einflussfaktoren überwiegend getrennt voneinander untersucht worden – mit teils widersprüchlichen Forschungsergebnissen.
Mit dem Blick für das Detail
Um dies zu ändern, haben die Forscherin und ihr Team drei Jahre lang Äcker in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Bayern genauer unter die Lupe genommen. Sie hinterfragten, wie gut diese als Lebensraum für Hummel und Co. taugen. Drei Betriebe mit jeweils 15 Flächen wählten sie für ihre Untersuchung aus − zwei konventionell und einen ökologisch wirtschaftenden. Zunächst musste ermittelt werden, welche Bestäuberarten auf den Äckern in welcher Anzahl vorkommen. Von April bis Oktober wurden Insektenfallen aufgestellt und alle zwei Wochen kontrolliert. Insgesamt bestimmten Brandt und ihr Team 157 Arten. Die 23 häufigsten, die zu sechs verschiedenen Insektengruppen gehörten, analysierten sie genauer. Zugleich erfassten sie, welche Feldfrüchte zum jeweiligen Zeitpunkt wuchsen, wie hoch die Pflanzen waren, wie viel Boden diese bedeckten und welche Ackerwildkräuter vorkamen. Zusätzlich schauten sie sich die nähere Umgebung im Umkreis von einem Kilometer genauer an: Wurden auch die Nachbarflächen bewirtschaftet? Gab es Siedlungen in der Nähe? Wie hoch war der Anteil an Wald, Grünland oder an naturnahen Büschen, Hecken und Brachflächen?
Die Ergebnisse zeigen, welche Lebensbedingungen positiv auf diese Bestäuberinsekten wirken und welche Handlungsspielräume die Landwirtschaft hat, um sie gezielt zu fördern.
Biene ist nicht gleich Biene
Bisher zeigen die Ergebnisse vor allem eines: Schwebfliegen, Honigbienen, Hummeln, aber auch weniger bekannte Furchenbienen, Sandbienen oder Mauerbienen – sie alle sind häufige und wichtige Gäste auf den beobachteten Flächen. Doch ihre Ansprüche an Futterquellen und Nistmöglichkeiten unterscheiden sich teils sehr stark. Während etwa Sandbienen auf einen trockenen Platz mit lockerem Boden angewiesen sind, benötigen einige Hummelarten für ihre Nester bodennahe Hohlräume. Viele Sandbienenarten sind ausschließlich im Frühjahr als Fluginsekten aktiv und brauchen dann Nahrung in Form von Pollen und Nektar. Bei der Schwebfliege ist das umgekehrt, denn sie hat erst im August Hochsaison. Hummelvölker sind dagegen vom Frühjahr bis in den Herbst hinein fliegend unterwegs – und entsprechend hungrig. »Wir müssen die Unterschiede in den Lebensweisen der einzelnen Gruppen berücksichtigen. Man kann nicht verallgemeinernd sagen, dass diese oder jene Maßnahme gut für Blütenbesucher ist«, fasst Brandt die Ergebnisse zusammen. Bevor man also in einem Gebiet Schutzmaßnahmen umsetzt, gilt es zunächst herauszufinden, welche Bestäuberinsekten dort unter natürlichen Bedingungen vorkommen, um diese dann gezielt zu fördern. »Die eine Lösung für alle gibt es nicht.«
Die Herausforderung ist es, so viele verschiedene Bestäuberarten wie möglich unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse zu schützen, denn nur so kann die benötigte Bestäubungsleistung insgesamt nachhaltig gesichert werden. So wurde zum Beispiel die Rolle der Wildbienen bisher unterschätzt. Jüngste Studien zeigen: Diese hocheffizienten Bestäuber, die meist nicht in Staaten, sondern einzeln leben, bestäuben Kulturarten doppelt so effektiv wie die Honigbiene, fliegen auch bei niedrigen Temperaturen aus und besuchen mehr Blüten.
Gerade für jene Insekten, die im Spätsommer und Herbst noch ein reichhaltiges Nahrungsangebot benötigen, ist das Überleben in der Agrarlandschaft meist schwierig. »Das Problem sind häufig sogenannte Nahrungslücken«, erklärt Brandt. Eine Rapsmonokultur bietet im Frühsommer beispielsweise drei bis fünf Wochen lang Nektar und Pollen im Überfluss. Ist der Raps aber verblüht, bricht für die bestäubenden Insekten eine magere Zeit an. Ist ein Imker vor Ort, bringt dieser die Bienenvölker dann zu ergiebigeren Nahrungsgründen. Wildinsekten steht dieser Shuttleservice jedoch nicht zur Verfügung. Nur an den Feldrändern blühende Wildkräuter oder andere blühende Kulturpflanzen retten sie dann noch vor dem Hungertod.
Dabei bieten erweiterte Fruchtfolgen, die abwechslungsreiche Nahrung über einen langen Zeitraum bereitstellen, durchaus Alternativen. Statt auf immer nur dieselben Kulturpflanzen wie Mais oder Weizen zu setzen, könnten etwa Klee, Hülsenfrüchte oder auch neue Energiepflanzen, wie die Durchwachsende Sylphie, in die Fruchtfolge eingebunden eine attraktive zusätzliche Nektar- und Pollenquelle sein. Auch Blühstreifen mit ganzjährig blühenden Wildkräutern können die Nahrungslücke in der kritischen Zeit schließen.
Ein weiterer Grund für den seit langem dramatischen Rückgang der Insektenpopulationen sind nicht nur fehlende Lebensgrundlagen, sondern auch eine häufig angewandte Gruppe von Insektiziden: Neonikotinoide, welche die Nervenzellen von Insekten angreifen und hochwirksam sind, werden von den Pflanzen aufgenommen und nur sehr langsam abgebaut. Die Kulturpflanzen sind dann zwar gegen Schädlinge geschützt, doch der Wirkstoff gelangt auch in Pollen und Nektar. In Laborstudien zeigte sich, dass dieser Bestäuberinsekten schädigt. Unter Freilandbedingungen sind die bisherigen Forschungsergebnisse nicht eindeutig, denn die Datenlage ist noch zu dünn.
Für die Landwirtschaft existenziell
Ein intaktes Bestäubersystem ist nicht nur für die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern vor allem auch für die Landwirtschaft existenziell. »Vielen ist bewusst, wie wichtig die Leistung der Bienen und Hummeln für ihre Kulturpflanzen ist«, weiß Brandt. »Doch häufig schrecken sie vor den strengen EU-Richtlinien zurück, wenn es um konkrete Maßnahmen geht.« Um Gelder für den Ertragsausfall zu erhalten, muss ein Blühstreifen am Feldrand, der Insekten über ihre gesamte Lebensspanne hinweg Nahrung und Lebensraum bietet, zu einem genau definierten Zeitpunkt in einer exakt vorgegebenen Breite ausgesät werden. Weicht der Bauer von den Vorgaben ab, hat er mit empfindlichen finanziellen Einbußen zu rechnen. Und auch der bürokratische Aufwand sei für die Landwirte häufig so hoch, dass sie lieber so weitermachten wie bisher. Mehr Flexibilität und Pragmatismus wünscht sich Brandt von der Politik, um den Umstieg auf eine insektenfreundliche Landwirtschaft zu erleichtern.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen: Es gibt keine Patentlösung. Jede Umgebung hat ihre eigene Bestäubergemeinschaft, die es zu schützen gilt. Mit den gewonnenen Daten wollen die Forscherinnen und Forscher zukünftig in ökologischen Modellen vorhersagen, wie sich die Insektengemeinschaft je nach angebauter Kultur und Landschaftsmerkmalen entwickeln wird. Fest steht für Brandt jedenfalls eines: »Wenn wir die Bestäuberleistung erhalten wollen, müssen wir die Biodiversität der Landschaft sowie der Kulturarten bewahren und ihre Zusammenhänge verstehen.«
Text: Heike Kampe
Karoline Brandt
ist Diplom-Geografin. Nach ihrem Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin forschte sie ab 2011 am ZALF im Institut für Landnutzungssysteme zu verschiedenen Organismengruppen der Agrarlandschaften. Heute arbeitet sie am Thünen-Institut für Biodiversität in Braunschweig.
Infomaterial und weiterführende Informationen: