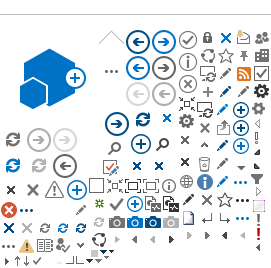10.04.2025

Müncheberg, 03. März 2025 – Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) hat herausgefunden, dass eine gezielte Diversifizierung des Anbaus die Einkommenssituation von Kakaobäuerinnen und -bauern in Côte d’Ivoire, der Elfenbeinküste in Westafrika, verbessern kann.
Haushalte, die neben Kakao auch andere Einkommensquellen auf separaten Flächen nutzen, erzielten ein Einkommen, das mehr als zweieinhalbmal so hoch ist wie das niedrigste gemessene Einkommen in den Untersuchungsregionen. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift
Frontiers in Sustainable Food Systems veröffentlicht.
Diversifizierung als Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg
Kakaoproduzentinnen und -produzenten in der Republik Côte d’Ivoire stehen vor großen Herausforderungen: schwankende Preise, von den Auswirkungen des Klimawandels bedrohte Ernteerträge sowie mangelnder Zugang zu Finanzierungen. Die Studie untersuchte, welche Anbauformen besonders erfolgreich sind und das Einkommen der Haushalte nachhaltig steigern können.
„Unsere Analyse zeigt, dass Kakaoproduzierende, die zusätzlich auf Einkommensquellen außerhalb des reinen Kakaoanbaus setzen, wirtschaftlich besser dastehen“, erklärt
Bonna Antoinette Tokou, Hauptautorin der Studie vom ZALF. „Vor allem Betriebe, die neben Kakao auf zusätzlichen Flächen ertragreiche, mehrjährige Pflanzen anbauen, erzielen ein deutlich höheres Haushaltseinkommen als solche, die nur Kakaoplantagen bewirtschaften.“
Vier Anbausysteme im Vergleich
Die Forscherinnen und Forscher untersuchten 303 Haushalte in fünf verschiedenen Regionen des Landes. Dabei identifizierten sie vier verschiedene Anbauformen:
-
Reiner Kakaoanbau – Monokultur ohne zusätzliche Pflanzen
-
Kakao mit Mischkulturen – Kombination von Kakao mit anderen Pflanzen auf derselben Fläche
-
Kakao plus zusätzliche Anbauflächen – Kakaoanbau kombiniert mit separaten Flächen für zusätzliche Einkommensquellen,
-
Kakao und Lebensmittelanbau – Kombination aus Kakao und Nutzpflanzen für die Eigenversorgung
Die Ergebnisse zeigen: Betriebe, die neben Kakaoplantagen weitere Flächen bewirtschaften, sind am weitesten verbreitet und erzielten die höchsten Einkommen, da auf zusätzlichen Flächen ertragreiche, mehrjährige Pflanzen angebaut werden. Kakaoplantagen mit Mischkulturen erzielten hingegen die höchsten Kakaomengen pro Hektar.
Frauen und Migrantinnen und Migranten setzen auf andere Strategien
Ein weiterer Fokus der Untersuchung lag auf der Frage, welche Gruppen welche Anbauformen bevorzugen. Dabei stellte sich heraus, dass Frauen häufiger auf die Kombination von Kakao mit Nahrungsmitteln für den Eigenbedarf setzen. Migrantische Produzentinnen und Produzenten hingegen nutzen besonders ertragreiche Kakaoanbauformen und erzielen überdurchschnittliche Einkommen durch Diversifizierung.
Doch es gibt ein Problem: Nur sieben Prozent der Befragten haben Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, um neue Anbauformen oder zusätzliche Flächen zu erschließen. „Ohne Kredite bleibt vielen Betrieben die Möglichkeit zur Diversifizierung verwehrt“, so Tokou.
Nachhaltige Kakao-Produktion braucht mehr Unterstützung
Die Studienergebnisse unterstreichen, dass eine gezielte Diversifizierung nicht nur das Einkommen stabilisiert, sondern auch die langfristige Nachhaltigkeit des Kakaoanbaus stärkt. Dennoch fehlt es an finanziellen und politischen Rahmenbedingungen, um diese Strategien flächendeckend zu fördern.
„Unsere Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Politik Maßnahmen ergreifen sollte, um Kakaoproduzierende bei der Diversifizierung zu unterstützen“, betont Tokou. „Dazu gehören nicht nur Finanzierungsangebote, sondern auch Schulungen und Beratung, um das Potenzial alternativer Einkommensquellen besser zu nutzen.“
Hintergrund: Das PRO-PLANTEURS-Projekt
Die Datenerhebung für die Studie fand im Rahmen des PRO-PLANTEURS-Projekts statt. Dieses Projekt unterstützt seit 2015 Kakaobäuerinnen und -bauern in Côte d’Ivoire dabei, ihre landwirtschaftlichen Praktiken zu verbessern, ihre Einkommen zu steigern und nachhaltigere Anbaumethoden zu etablieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Förderung von Frauen und jungen Menschen. Die Teilnehmenden des Projekts erhalten Schulungen in guter landwirtschaftlicher Praxis, diversifizierter Produktion und betriebswirtschaftlichem Management.
Methodik der Studie
Die Untersuchung basierte auf einer Haushaltsbefragung von 303 Kakaobäuerinnen und -bauern in fünf Regionen von Côte d’Ivoire. Die Befragungen fanden im Juni und Juli 2022 statt und konzentrierten sich auf landwirtschaftliche Praktiken, Einkommen, Produktionskosten und erhaltene Schulungen.
Zur Datenerhebung wurde die Kobo Toolbox, eine Open-Source-Plattform für digitale Umfragen, genutzt. Die Analyse erfolgte mit deskriptiven Analysen, Varianzanalysen (ANOVA) und multivariater Regressionsanalyse, um Zusammenhänge zwischen Diversifizierungsstrategien und Einkommen zu identifizieren.
Hinweis zum Text:
Dies ist eine mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellte Zusammenfassung des Originaltextes: Tokou BA, Coral C, Montiel FI, Adou Yao CY, Sieber S und Löhr K (2025) Diversification strategies to improve cocoa farmers’ household income: the case of Côte d’Ivoire. Front. Sustain. Food Syst. 9:1524997.
DOI: 10.3389/fsufs.2025.1524997, veröffentlicht unter der Lizenz
CC BY 4.0.
Der Text wurde unter den Gesichtspunkten der KI-Regelungen am ZALF sorgfältig überprüft und überarbeitet.
Projektpartner:
- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.
- University Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire
Förderhinweis:
Diese Forschung wurde im Rahmen des PRO-PLANTEURS Recherche Projekts durchgeführt, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert wird. Die in dieser Studie geäußerten Ergebnisse und Schlussfolgerungen spiegeln nicht notwendigerweise die Positionen oder Richtlinien des BMZ wider.
Weitere Informationen: