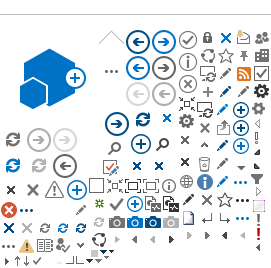19.06.2024
Abschlussveranstaltung Projekt „MikroMais“:
Mais in Veredelungsregionen effizienter und gewässerschonend düngen
11. Juni 2024 in Cadenberge
„Es ist allgemein bekannt, dass wir seit fast 30 Jahren einen kontinuierlichen Stickstoffbilanzüberschuss im Pflanzenbau haben“, sagte Professor Frank Eulenstein vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Projektleiter im Vorhaben „MikroMais“ am Dienstag, dem 11. Juni 2024 in der neu eingeweihten Halle des Maschineringes „Land Hadeln“. Anders ausgedrückt: „Nur rund jedes zweite gedüngte Kilogramm Stickstoff kommt letztlich in die Pflanze, der Rest kommt sonst wohin – in die Atmosphäre, ins Grundwasser – das gravierendste ökologische Problem, das wir in der deutschen Landwirtschaft haben“, erklärt Eulenstein
vor 212 Gästen. Aber auch ein Zuviel an Phosphor ist bedenklich: Phosphorverbindungen sind nicht leicht löslich und reichern sich im Boden an. Vor allem bei Starkregen verlagern sie sich dann in die Gewässer und führen dort zu übermäßigem Algenwachstum zu Ungunsten einer artenreichen Unterwasserflora und -fauna.
Im Projekt "MikroMais", das vom BMEL über die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR) gefördert wurde, konnte ein Lösungsansatz für den Maisanbau in Regionen mit einem hohen Überschuss an Wirtschaftsdüngern (Gülle, Mist, Biogasgärreste = organische Dünger mit langsamer Nährstofffreisetzung) erprobt werden. Hier sind die Herausforderungen besonders groß, die Düngebilanzen einzuhalten, denn die Bäuerinnen und Bauern wollen und müssen einerseits ihre Wirtschaftsdünger auf die Felder ausbringen, müssen andererseits aber auch eine schnellwirksame mineralische Düngung zur Maisaussaat verabreichen, da die Pflanzen gerade in der Jugendentwicklung einen hohen Nährstoffbedarf haben. Da kann die Düngebilanz schnell aus dem Ruder laufen. In der Folge bleibt vielen Betrieben nichts Anderes übrig, als einen Teil ihrer Wirtschaftsdünger zu hohen Kosten in andere Regionen zu exportieren.
In "MikroMais" drillen die Forschenden den Mais zusammen mit einem direkt am Saatgut platzierten, effizienten Mikrogranulatdünger sowie mit Mykorrhizapilzen und phosphor- und stickstoffmobilisierenden Bakterien mit einem speziellen Mikrogranulatstreuer aus. Daneben erhält der Mais nur Wirtschaftsdünger, aber keine weiteren mineralischen Düngemittel.
Mikrogranulatdünger sind hochkonzentriert und leicht löslich; sie sparen gegenüber den praxisüblichen Mineraldüngern insbesondere Phosphor, aber auch Stickstoff ein. Die Mykorrhizapilze und Bakterien gehen Symbiosen mit den Pflanzen ein und helfen ihnen, aus dem Nährstoffangebot das Maximale herauszuholen. Die Idee ist, dass der Landwirt auf diese Weise seinen Wirtschaftsdünger effizient nutzen kann und nicht exportieren muss, Mineraldünger einspart und trotzdem hohe Maiserträge bei verringertem Risiko von Nährstoffverlusten realisiert.
Dass diese Strategie funktioniert, konnten die dreijährigen Ergebnisse des FNR-Vorhabens zeigen, das noch bis März 2024 lief. Im Ergebnis konnten gleiche zum Teil auch höhere Erträge bei deutlich niedrigeren Nährstoff-Bilanzüberschüssen auf tonigen, sandigen und organogenen Böden erhoben werden, wobei die beste Wirkung auf den „leichteren“ Standorten erzielt wurde. Auf den sandigen Standorten wurde weiterhin eine signifikante Veränderung des Boden-Mikrobioms durch den Einsatz der Mikroorganismen festgestellt. Diese Veränderung äußerte sich in einer allgemeinen Zunahme der absoluten Mikroorganismenzahlen, was grundsätzlich für einen intakteren Boden spricht, sowie einer Abnahme der Gruppe der Firmicutes.. Insgesamt zeigte sich ein beeindruckend geringer Zusammenhang zwischen der in den unterschiedlichen Düngevarianten zugeführten Phosphor-Menge je Hektar und den Erträgen. Mit anderen Worten lohnt es sich für die Landwirtschaft und die Umwelt, auch abseits der üblichen Düngeschemen nach Lösungen zu suchen. Neben der neuen Applikationstechnik für Mikrogranulate kamen auch neueste Nahinfrarot-Spektroskopie-Technik am Feldhäcksler (Fa. Krone) und Drohnen mit Multispektralkameras zum Einsatz um Inhaltstoffe der Pflanzen zu bestimmen!
Projektpartner waren das ZALF und die Universität Rostock. Unterstützung kam von zahlreichen Praxispartnern aus den Bereichen Agrarhandel, Maschinenring, Saatgut-, Mikroorganismen- und Düngemittelherstellung.
Bearbeitet wurde das Projekt am ZALF von Lena Geist, Renate Wolfer, Matthias Thielicke, Marina Müller, Marion Tauschke und Frank Eulenstein. Der Abschlussbericht wird zum 30. Juni 2024 erstellt.