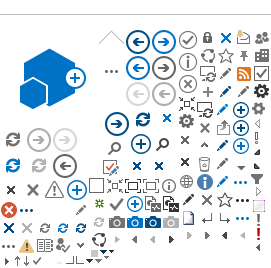15.07.2025

Ein Forschungsteam unter Mitwirkung des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) hat im Fachjournal Energy Research & Social Science untersucht, wie der Übergang zu einer sogenannten Bioökonomie – also einer Wirtschaftsweise, die statt fossilen auf nachwachsenden Rohstoffen basiert – gerecht und nachhaltig gestaltet werden kann. Der Perspektivartikel entstand aus der Zusammenarbeit der Leibniz-Netzwerk-Arbeitsgruppe „Bioökonomie“ der Sektion „Erde und Gesellschaft“. Die Autorinnen und Autoren beleuchten ökologische, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen und zeigen Wege auf, wie Zielkonflikte zwischen Klimaschutz, Biodiversität und sozialer Gerechtigkeit besser gelöst werden können.
Die Idee hinter der Bioökonomie ist es, fossile Rohstoffe wie Erdöl durch nachwachsende biologische Ressourcen wie Holz oder Pflanzen zu ersetzen – etwa für Energie, Baustoffe oder Bioplastik. Damit sollen klimaschädliche Emissionen reduziert werden. Doch die steigende Nachfrage nach Biomasse bringt neue Probleme mit sich: Für den Anbau nachwachsender Rohstoffe wird Fläche benötigt, was in vielen Ländern die Abholzung von Wäldern oder den Verlust von natürlichen Lebensräumen zur Folge haben kann. Besonders betroffen ist der Globale Süden, wo oft große Landflächen für den Anbau von Energiepflanzen genutzt werden – mit negativen Folgen für Ernährungssicherheit und lokale Gemeinschaften.
Es reicht nicht, nur auf das Klima zu schauen
„Die Energiewende hin zu einer Bioökonomie darf nicht auf Kosten von Menschen im Globalen Süden oder der biologischen Vielfalt gehen“, sagt Dr. Maren Dubbert vom ZALF, Mitautorin des Artikels. „Nur wenn wir Umweltwirkungen, Biodiversität und soziale Gerechtigkeit gemeinsam betrachten, kann eine gerechte Transformation gelingen.“
„In Europa sehen wir besonders kritisch, dass bestehende EU-Strategien häufig wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund stellen, während soziale Fragen und tatsächliche Umweltbelastungen zu wenig Beachtung finden“, ergänzt Dr. Anette Ruml vom Deutschen Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA), Erstautorin der Studie. „So werden beispielsweise große Mengen Palmöl für Biodiesel aus Ländern wie Indonesien importiert – obwohl dafür Regenwald gerodet und die Lebensgrundlage vieler Menschen vor Ort zerstört wird.“
Der Systemwechsel braucht eine breite Beteiligung und politische Abstimmung
Die Studie hebt hervor, dass für eine faire Bioökonomie alle relevanten Akteurinnen und Akteure an einen Tisch geholt werden müssen: Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Forschung und betroffene Gemeinschaften. Die Autorinnen und Autoren fordern partizipative Verfahren und globale Zusammenarbeit, etwa bei der Gestaltung nachhaltiger Lieferketten, dem Zugang zu Land und Technologie sowie der Entwicklung gemeinsamer Regeln – mit möglichst geringem bürokratischem Aufwand.
Gleichzeitig kritisieren sie die mangelnde politische Abstimmung innerhalb der EU: Maßnahmen in Bereichen wie Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Energie und Industrie seien oft nicht aufeinander abgestimmt. Auch neue EU-Vorschriften, wie Sorgfaltspflichten für entwaldungsfreie Produkte, greifen zu kurz – weil sie nur für Großunternehmen gelten und andere Umweltrisiken wie Bodendegradation oder Wassermangel nicht erfassen.
Ausblick: Bioökonomie als Chance für den Wandel – wenn sie ganzheitlich gedacht wird
Die Forschenden schlagen vor, die Bioökonomie in einen größeren Forschungsrahmen zu integrieren, der sowohl ökologische als auch gesellschaftliche Systeme berücksichtigt. Nur so lassen sich die komplexen Wechselwirkungen und globalen Abhängigkeiten ausreichend verstehen und bewerten. Zentrale Fragestellungen seien: Wer profitiert von der Bioökonomie? Welche Risiken bestehen für Mensch und Umwelt? Und wie können unterschiedliche Interessen gerecht abgewogen werden?
Ein gerechter Wandel braucht wissenschaftlich fundierte Leitplanken – beispielsweise die definierten planetaren Belastungsgrenzen – sowie offene Dialogformate mit allen Beteiligten. So könne die Bioökonomie zu einem Motor für eine nachhaltige Zukunft werden: sozial gerecht, ökologisch tragfähig und wirtschaftlich sinnvoll – innerhalb der Grenzen unseres Planeten.
Projektpartner:
- GIGA – Deutsches Institut für Globale und Regionale Studien, Hamburg
- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V., Müncheberg
- Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), Stechlin
- Institut für Biochemie und Biologie, Universität Potsdam, Potsdam
- Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB), Halle
- Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam
Weitere Informationen:
Link zur Originalpublikation:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629625001707#f0010
Hinweis zum Text:
Dies ist eine mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellte Zusammenfassung des Originaltextes: Ruml, A., Chen, C., Kubitza, C., et al. (2025). Minimizing trade-offs and maximizing synergies for a just bioeconomy transition, Energy Research & Social Science, 125, 104089. https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104089, veröffentlicht Open Access unter der Lizenz CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Der Text wurde unter den Gesichtspunkten der KI-Regelungen am ZALF sorgfältig überprüft und überarbeitet.